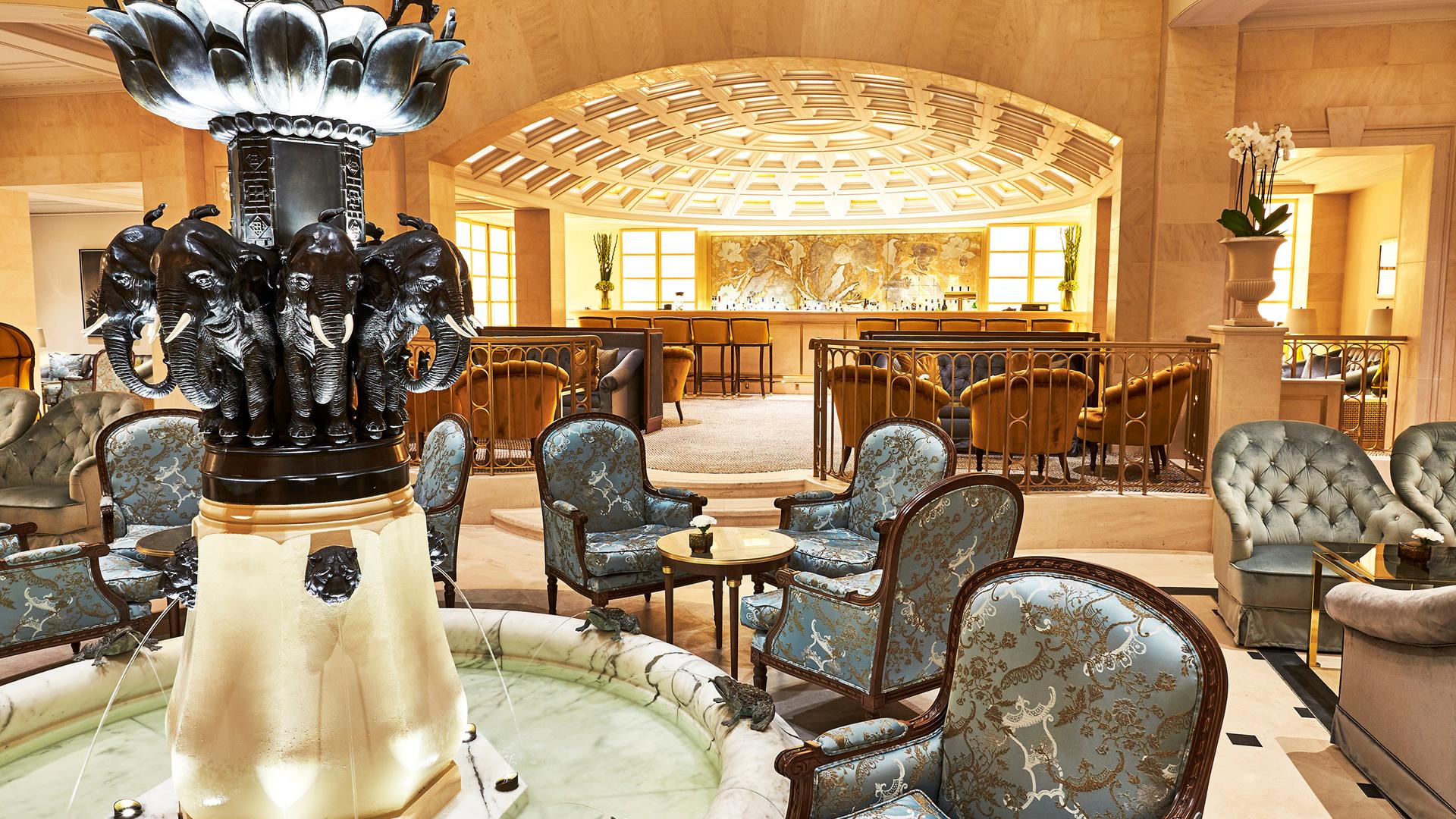Können ja, und vor allem: sollen! Schachcafés, Bars, Vereine, Museen, Parks mit Freiluftschach und Grabstätten – wer einen Ort kennt und einträgt, dem bin ich wirklich dankbar. Die Seite lebt vom kollektiven Gedächtnis. Ich selbst war viel zu lange nicht aktiv im Schach, als dass ich da viel beisteuern könnte – außer der Plattform. Das Eintragen geht wirklich schnell, da ich vieles automatisiert habe. Man kann die Einträge auf Englisch, Deutsch, Französisch oder Spanisch machen. Das wird alles automatisch übersetzt, wobei Schachbegriffe manchmal etwas holprig klingen. Man kann sogar Orte eintragen, die es nicht mehr gibt. Diese markiere ich dann bewusst als „geschlossen“. Das ist für all jene hilfreich, die die Orte noch von früher kennen. Es ist quasi eine Art Friedhof für Schachorte, damit sie nicht vergessen werden.
Wie viele der gelisteten Schachorte haben Sie selbst schon besucht?
Da ich die Seite betreibe, klopft natürlich ständig das schlechte Gewissen an. Wenn ich irgendwo hinreise, egal, ob beruflich oder im Urlaub, suche ich gezielt nach Schachorten und trage sie ein, falls sie fehlen. Meistens sind das die Klassiker: In Island war es das Grab von Bobby Fischer, in Estland das Paul-Keres-Haus in Tallinn. Ich frage auch immer, wo sich Schachspieler treffen. Als ich in Dschidda war, lotste man mich in ein neues Café, in dem Schach gespielt wird. Das war deshalb für mich besonders, weil das bis vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen wäre. Es gab in Saudi-Arabien immer mal wieder recht fragwürdige islamische Rechtsgutachten zum Schach, die das Spiel verbieten wollten.
Was motiviert Sie eigentlich, so viel Mühe in dieses Projekt zu stecken?
Ich bin in Österreich in einem Bergdorf im hinteren Klostertal aufgewachsen, ein Arbeiterkind. Damals in der Hauptschule spielten meine Freunde plötzlich in der Pause Schach. Ich hatte bis dahin noch nie Schachfiguren in der Hand gehabt. Wir wurden alle in kürzester Zeit quasi süchtig danach, spielten pausenlos und gründeten eine Mannschaft, mit der wir zwei Mal österreichischer Bundesmeister bei den Schulen wurden. Wir sind damals viel herumgekommen. Ich bin jetzt 48 Jahre alt und rückblickend würde ich sagen: Man lernt Dinge sehr schnell und gut, wenn Obsession und Leidenschaft zusammenkommen. Das war bei mir damals definitiv der Fall.
War Schach damals eine Art Flucht?
Ja, mein bester Freund von damals schrieb mir vor ein paar Jahren, Schach sei für uns wohl so eine Art „Social Elevator“ gewesen. Eine Möglichkeit, aus dieser einfachen Welt auszubrechen, aus der wir kamen – ohne Geld, ohne Netzwerke. Schach hat uns eine neue Welt eröffnet. Bis heute war das eine unglaublich schöne Zeit mit vielen Erinnerungen. Irgendwann hatte ich dann die Idee – auch wenn das jetzt etwas hochtrabend klingt – dem Schach etwas zurückzugeben, damit es auch als Kulturgut erhalten bleibt. So ist die Seite
64.place allmählich entstanden.
Gibt es einen Ort, der Ihnen persönlich besonders viel bedeutet?
Ja, das Gasthaus „Stern“ in Bludenz in Vorarlberg. Ende der 1990er-Jahre haben wir uns dort immer wieder zum Blitzen verabredet. Wir saßen in einer Ecke hinter dem Stammtisch, wo meistens gejasst (Anm. d. Red.: ein Kartenspiel) wurde, es liefen Schlager und es wurde Kette geraucht. Gespielt haben wir so lange, bis sich die Wirtin nicht mehr mit neuen Getränke-Bestellungen überreden ließ. Oft spielten wir dann noch woanders weiter, holten, falls nötig, noch schnell was bei einer Tankstelle, und ich kam nicht selten erst um 5 Uhr morgens nach Hause.
Was hat diese Abende so besonders gemacht?
Das war die Gruppe. Wir hatten nicht nur viel Spaß, ich habe damals auch gelernt, wie kompliziert und schön Schach sein kann. Ich traf mich dort meistens mit Günter Amman, der ein paar Jahre später FM wurde und sich trotz seiner Spielstärke nicht zu schade war, mit uns stundenlang zu blitzen. Günter hat mir damals viel beigebracht, vor allem: wie Schach funktioniert. Er hatte damals angefangen, Studien zu komponieren, und stellte die dann immer mal wieder zu später Stunde aufs Brett.
Konnten Sie die denn lösen?
Nein, meistens nicht einmal ansatzweise. Aber das Schöne an Studien ist ja eigentlich, dass man zunächst mal verstehen muss, welche Stärken, Schwächen und Funktionen jede Figur hat. Das fasziniert mich bis heute. Einige Studien von Günter Amann wurden später mit Preisen ausgezeichnet. 2012 gab es bei einem Wettbewerb nicht nur den ersten Preis, sondern auch Lob vom Juror – von GM John Nunn höchstpersönlich.
Günter hatte später eine lange Schachpause eingelegt. Erst vor Kurzem hat er wieder ein paar Partien gespielt. Diesen Sommer war ich auf Besuch in Österreich, wir riefen uns zusammen und blitzten wieder im Gasthaus „Stern“. So ein bisschen wie in alten Zeiten. Die Wirtsleute heißen Schachspieler immer noch willkommen.
Spielen Sie selbst noch aktiv – oder eher gelegentlich?
Ich hatte mehr als fünfzehn Jahre keine einzige Partie gespielt, nicht mal online. Das lag vor allem daran, dass ich zwölf Jahre im Nahen Osten und in Nordafrika gelebt hatte und meine Interessen ganz woanders lagen. Schach hatte ich als eine wunderbare Episode aus früheren Zeiten verbucht. Kurz vor der Corona-Pandemie bin ich mit meiner Frau Mey nach Berlin gezogen. Während des Lockdowns habe ich dann alte Hobbys wiederentdeckt: also auch Schach.
Wie findet man als Schach-Wiedereinsteiger in einer neuen Stadt wie Berlin Anschluss?
Ich kannte keine Schachspieler. Ich habe dann eines Tages einfach eine E-Mail an den Deutschen Schachbund geschickt, an die Adresse, die im Impressum stand. Es war irgendwas mit „webmaster“. Ich hatte echt nicht mit einer Antwort gerechnet. Es dauerte genau 24 Minuten, dann meldete sich Frank Binding (damals noch Frank Hoppe) mit einer freundlichen und ausführlichen E-Mail und bot mir gleich seinen Verein als Lösung an: den SV Berolina Mitte im Prenzlauer Berg. Der war zwar etwas weit von mir, ich wohne in Friedrichshain, aber das Spiellokal von Berolina ist das Café „En Passant“. Dessen Betreiber, Sven Horn, ist ein begeisterter wie guter Schachspieler. Genau so etwas hatte ich gesucht. Ich bin dann also in den Verein eingetreten.
Gerald Drißner (links) beim Spielen im Schachcafé En passant (Foto: Frank Binding)
Und wie lief's dann? Wie fühlt es sich an, nach so vielen Jahren wieder am Brett zu sitzen?
Ich habe schnell gemerkt, dass Schachspielen leider nicht wie Radfahren ist, sondern eher das gleiche Schicksal teilt wie Fremdsprachen aus der Schulzeit: Wenn man sie nicht pflegt, ist nicht mehr viel da. Gefühlsmäßig verliert man pro zehn Jahre Nichtspielen gut 150 DWZ-Punkte an Spielstärke. Was geblieben ist, ist ein gewisses Verständnis für Stellungen – aber vieles davon ist inzwischen einfach auch Quatsch. Früher hatte ich Bullet mit mechanischen Uhren gespielt. Heute ist meine Blitz-Motorik weg, ich lasse oft einzügig eine Figur stehen und verliere immer mal wieder auf Zeit. Es macht aber trotzdem Spaß.
Heißt das, die alte Leidenschaft ist verflogen?
Gemessen an früher, ja. Ich bin viel unterwegs und habe nicht wirklich Zeit für Schach und vor allem auch keinen Ehrgeiz, besser zu werden, da ich zu viele andere Dinge am Laufen habe. Ich habe mir sogar ein paar Schachbücher bestellt, die liegen aber ungelesen im Regal. Das gilt leider auch für die Zeitschrift „Schach“ – das ist inzwischen eher ein Solidaritätsabo. In Berlin wird die Mannschaftsmeisterschaft sonntags um 9 Uhr morgens gespielt. Damals in Österreich war es Freitag, 19 Uhr. Ich bin wirklich kein Morgenmensch. Ich habe mich dennoch als Ersatzspieler für die Mannschaftskämpfe aufstellen lassen. Wenn ich da bin und Spieler fehlen, springe ich gerne ein.
Als Journalist: Gibt es unter Ihren Kolleginnen und Kollegen eine kleine Schachszene?
Also sollte es die geben, würde ich mich über eine Einladung sehr freuen – vor allem von den Berliner Kollegen. Ich weiß es nämlich nicht, ich war zu lange im Ausland. Das letzte Mal, dass ich mit einem Kollegen Schach gespielt habe, war vor ziemlich genau zwanzig Jahren beim Magazin „Stern“ in Hamburg. Ich habe dort zunächst als Journalistenschüler und später als Redakteur im Deutschland-Ressort gearbeitet. Thomas Schumann war damals Textchef. Er ist nicht nur ein guter Spieler, er hatte 1991 Bobby Fischer in der Pulvermühle aufgespürt und darüber geschrieben. [
Vgl. Schachgeflüster Podcast-Interview].
Wenn Sie selbst ein Schachcafé eröffnen würden – wie würde es heißen, und was dürfte dort auf keinen Fall fehlen?
Ich habe riesigen Respekt vor allen Menschen, die ein Schachcafé betreiben und noch nicht aufgegeben haben. Dazu gehört viel unbezahlte Leidenschaft wie übrigens auch bei den Ehrenamtlichen in den Vereinen. Ich wäre ganz sicher kein guter Wirt. Was aber auf keinen Fall fehlen dürfte: zumindest Erdnüsse oder Salzstangen. Irgendwas zum Getränk. Ich war vor einem Jahr in Athen im legendären Café Panellinion, wo zu den besten Zeiten auch Schachweltmeister zu Gast waren. Dort wurde ständig Oliven, Käse und anderes Fingerfood an die Tische gebracht, wie es in Griechenland üblich ist. Und wenn das Glas leer war, kam schnell ein volles Neues, meistens automatisch. Da bleibt man dann gerne und vor allem lange.
Und zum Schluss: Wo würden Sie gern einmal die ganze Nacht durchblitzen?
Meistens sind die ungeplanten Abende und Nächte die schönsten. Der Ort ist da gar nicht so wichtig. Schach hat den großen Vorteil, dass man es fast überall spielen kann, da man nur wenige Dinge braucht: Brett, Uhr, Gegner – und natürlich was zu trinken.
Links: