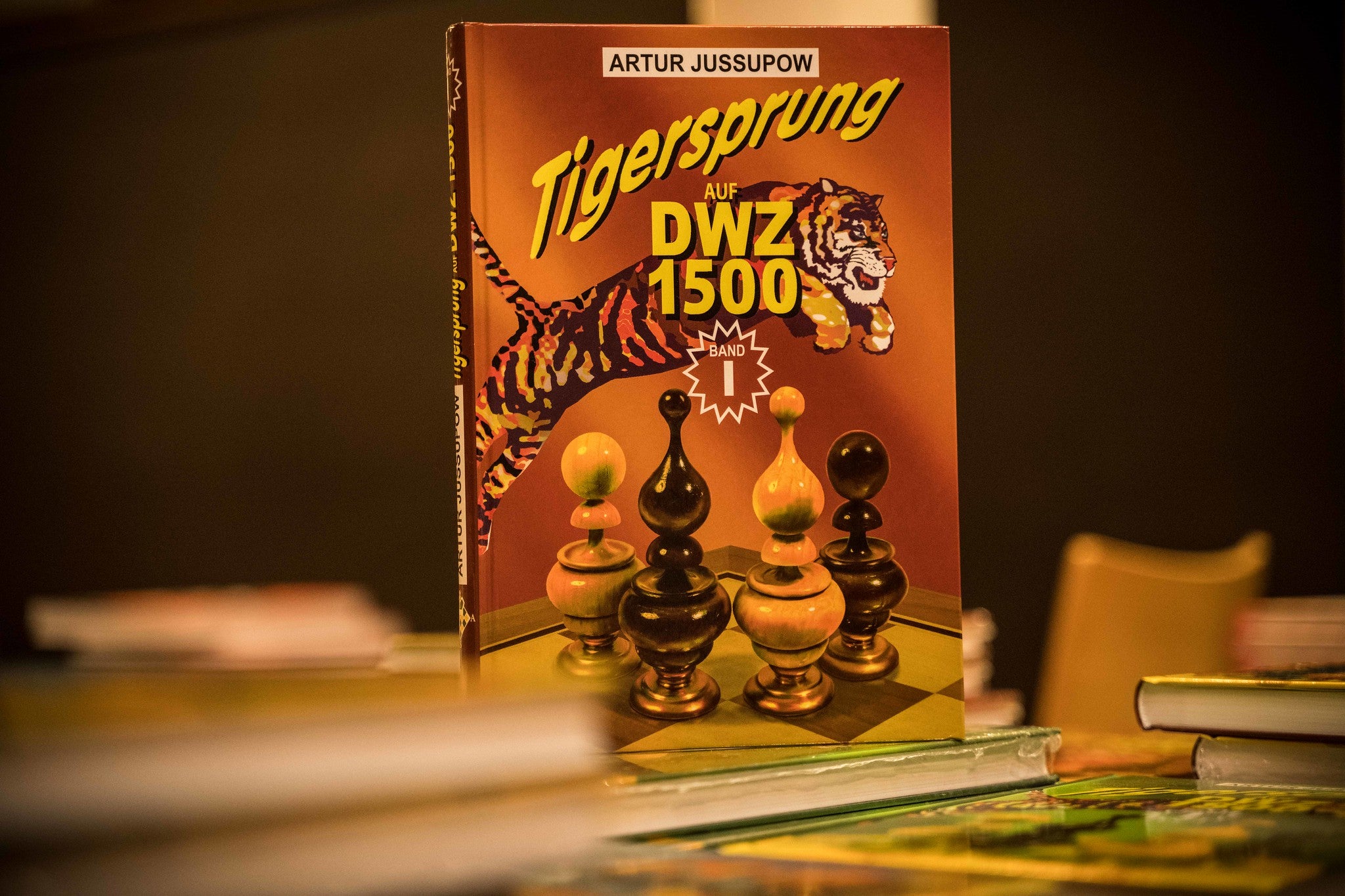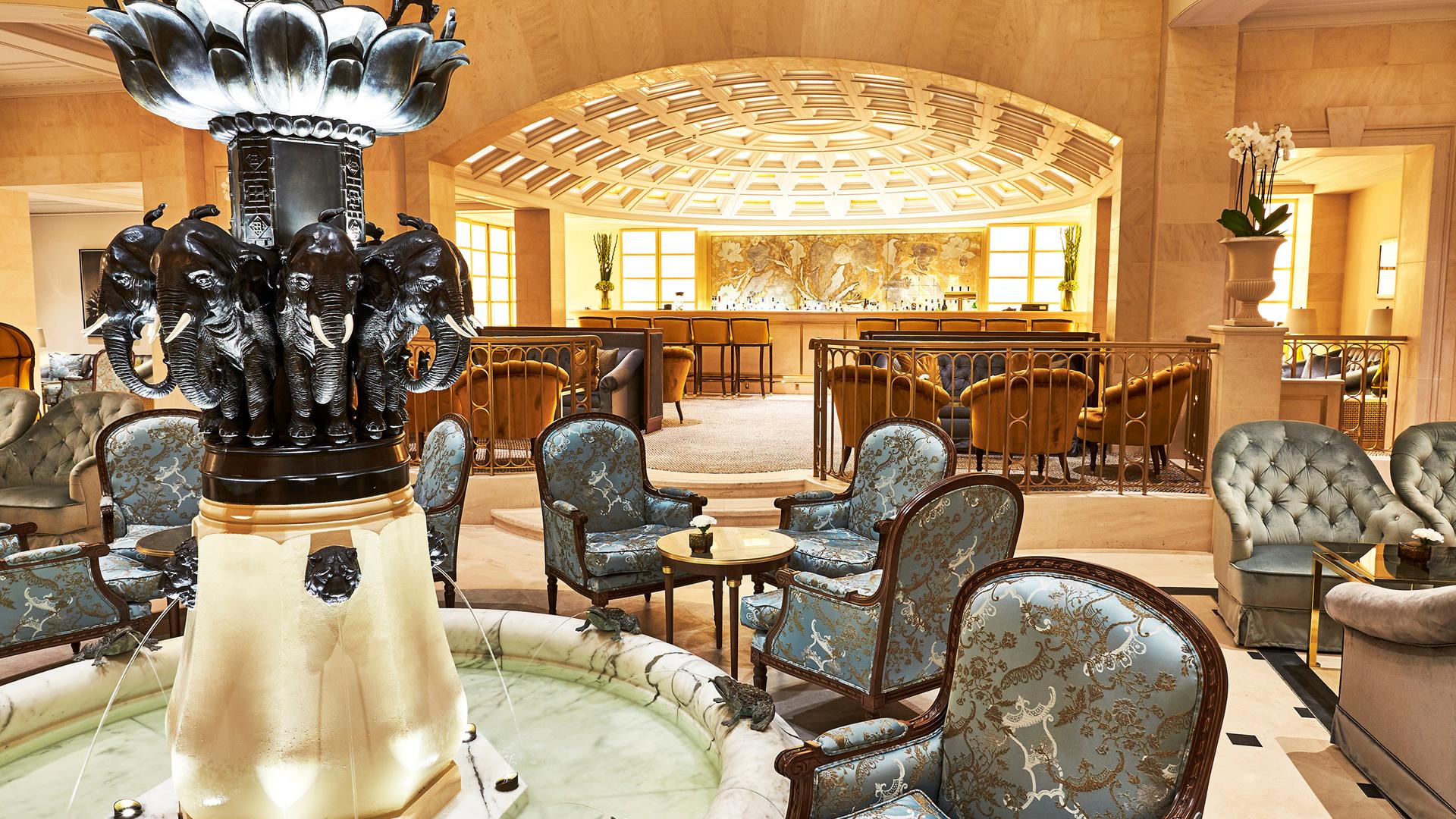In der neuesten Folge ihres Podcasts „Schach für Kinder“ nimmt uns Xenia Bayer mit in eine Welt, die im Schatten des Schachbretts tickt – wortwörtlich. Es geht um die Schachuhr – jenes unscheinbare Gerät, das Spiele gewinnt, Spieler nervös macht und ganze Turnierpläne kippen kann.
Wie kam es eigentlich dazu, dass Sekunden über den Ausgang eines Spiels entscheiden? Was passierte, bevor es überhaupt Uhren beim Schach gab? Und warum wurde Bobby Fischer zum Erfinder einer Zeitkontrolle, die heute weltweit Standard ist?
Vom Sandrieseln im 19. Jahrhundert bis zum digitalen Zeitdruck im Blitzstream – diese Folge ist eine kleine Zeitreise durch das, was Schach wirklich spannend macht: die Begrenzung durch Zeit.
Oder, wie Xenia es ausdrückt:

Hier das vollständige Manuskript:
Hallo, liebe Zuhörer,
ich heiße Xenia Bayer. Willkommen zu meinem Podcast „Schach für Kinder“.
Abend. Zwei Spieler sitzen regungslos am Schachbrett, die Stirn in Falten gelegt.
Die Schachfiguren glänzen im Licht der Lampe. Beide haben nur noch wenige Sekunden auf der Schachuhr.
Einer von ihnen wird gleich auf Zeit verlieren – das ist sicher.
Weiß streckt die Hand aus. Der Springer? Nein – er zieht die Hand zurück.
Ein kurzer Blick aufs Brett, dann die Entscheidung: Weiß schiebt den Bauern vor.
Jetzt ist Schwarz dran. Er schaut aufs Brett, dann auf die Uhr. Noch drei Sekunden.
Seine Hand schwebt über dem Turm, zögert – die Fallklappe knallt herunter.
Die Zeit ist abgelaufen, die Partie ist verloren.
Schach und Zeit. Die Uhr macht es spannend.
Heute geht es um ein spannendes Gerät, das neben dem Schachbrett steht – und oft darüber entscheidet, wie das Spiel ausgeht: die Schachuhr.
Sommer 1883, London. Zum ersten Mal steht bei einem großen Schachturnier eine mechanische Uhr neben dem Schachbrett. Ein Wendepunkt.
Doch wie spielte man eigentlich Schach, bevor es Schachuhren gab?
Londoner Match, 1851.
Ein Schiedsrichter-Assistent vermerkt in seinem mitternächtlichen Protokoll:
„Die Partie wurde nicht beendet, da die Spieler schließlich eingeschlafen waren.“
Bevor es Schachuhren gab, konnten Schachpartien endlos dauern – nicht selten bis tief in die Nacht.
Zuschauer langweilten sich, Gegner wurden zermürbt, und Veranstalter verzweifelten am Zeitplan.
War ein Spiel an einem Tag nicht zu beenden, wurde es unterbrochen und am nächsten Tag fortgesetzt.
So entstand ein Begriff, der später fester Bestandteil der Schachsprache wurde: die Hängepartie.
Schon 1861, beim Wettkampf zwischen Adolf Anderssen und Ignaz von Kolisch, probierte man eine frühe Lösung zur Zeitmessung aus:
Zwei drehbare Sanduhren standen neben dem Schachbrett.
Nachdem ein Spieler gezogen hatte, kippte er seine Sanduhr waagrecht, und die des Gegners stellte er senkrecht.
War die Sanduhr eines Spielers leer, war die Partie verloren.
Doch diese Methode hatte einen großen Nachteil:
Der Sand floss nicht immer gleichmäßig – mal schneller, mal langsamer.
So entstand die große Frage: Wie kann man Zeit fair und genau messen?
Die Antwort kam aus Manchester.
Thomas Bright Wilson, Uhrmacher und zu der Zeit Sekretär des Schachvereins Manchester, hatte eine einfache, aber geniale Idee:
Zwei mechanische Uhren, verbunden durch einen Kippschalter.
Wenn ein Spieler zog, drückte er einen Hebel ,stoppte damit seine eigene Uhr und startete die des Gegners.
Diese Doppeluhr wurde erstmals beim Londoner Turnier 1883 eingesetzt:
Die Geburtsstunde der Schachuhr.
Die Zeitkontrolle wurde zum festen Bestandteil des Turnierschachs.
Ab 1883 wurde nicht nur gespielt – sondern auch gemessen.
Im 20. Jahrhundert wurden Schachuhren Standard.
Besonders verbreitet waren die Modelle der Firma Gardé aus Ruhla, Thüringen.
Diese Uhren aus Holz hatten zwei klassische Zifferblätter und einen Metallschalter oben, um die Bedenkzeit zwischen den Spielern umzuschalten.
Wer einmal in einem Turniersaal mit 50 solcher Uhren gespielt hat, kennt das Geräusch:
das rhythmische Ticken, das Klacken beim Drücken – es gehörte zum Spiel wie das Knarzen des Stuhls.
Aber so zuverlässig diese Uhren auch waren – ihre Möglichkeiten waren begrenzt.
Neue Zeitformate, wie sie sich später entwickelten, ließen sich damit nicht umsetzen.
In den 1980er-Jahren hielten digitale Schachuhren Einzug in die Turnierszene.
Sie ermöglichten nicht nur eine präzise Anzeige der verbleibenden Zeit, sondern auch ganz neue Zeitkontrollen - darunter das heute weitverbreitete Inkrement, bei dem pro Zug einige Sekunden zur Bedenkzeit hinzugefügt werden.
Die Idee dazu stammt vom 11. Schachweltmeister Bobby Fischer.
Er schlug vor, jedem Spieler bei jedem Zug eine kleine Zeitgutschrift zu geben, damit man in Zeitnot nicht nur hektisch ziehen muss, sondern durch genaues und überlegtes Spiel trotzdem überleben kann.
Das Prinzip der Inkrementzeit, auch Fischerzeit genannt: Bei jedem Zug wird dem Spieler
eine festgelegte Zeitspanne, meist einige Sekunden, zur verbleibenden Bedenkzeit addiert. Dadurch können Spieler Zeit ansparen, indem sie schnell ziehen, was taktische Vorteile mit sich bringt.
Ein klassisches Beispiel für eine solche Zeitkontrolle ist 90 Minuten plus 30 Sekunden Inkrement pro Zug. Bobby Fischers Zeitzuschlag hat sich inzwischen weltweit durchgesetzt.
Bei Weltmeisterschaften, in Online Blitzturnieren und sogar in Schulschachwettkämpfen
läuft heute fast alles mit Inkrement.
Digitale Schachuhren bieten auch eine Vielzahl unterschiedlicher Zeitmodi, die das Spiel abwechslungsreicher machen, darunter zum Beispiel die Delayzeit und der Sudden Death Modus Modus. Bei der Delayzeit zählt nicht sofort jede Sekunde runter. Stattdessen wartet die Uhr bei jedem Zug ein paar Sekunden, bevor die eigentliche Bedenkzeit abläuft. Wer also schnell zieht, verliert keine wertvolle Zeit. Im Gegensatz zur sogenannten Fischerzeit kann man diese Verzögerung allerdings nicht ansparen. Es ist vielmehr ein kurzer Zeitpuffer, eine kleine Denkpause auf Knopfdruck. Ein typisches Beispiel wäre eine Zeitkontrolle mit 30 Minuten plus 5 Sekunden Delay pro Zug. Dieser Modus ist vor allem in den USA sehr populär.
Der Sudden Death Modus dagegen ist einfach und gnadenlos. Wer seine Zeit braucht,
verliert sofort. Kein Aufschub, kein Puffer. Jahrzehntelang war dieses Zeitformat der
Standard, besonders bei mechanischen Schauchuren. Wer beispielsweise noch fünf Züge
machen musste, aber nur noch drei Minuten hatte, musste eben blitzschnell spielen.
Was früher meist im verborgenen stattfand, wird heute live und weltweit
übertragen.
Moderne digitale Schachuhren in Kombination mit elektronischen Schachbrettern
ermöglichen es, Stellung und verbleibende Bedenkzeit in Echtzeit ins Internet zu
streamen. So können Tausende Zuschauer rund um den Globus jede Partie Zug für Zug
und Sekunde für Sekunde verfolgen. Hikaru Nakamura ist ein US -amerikanischer
Großmeister und einer der bekanntesten Schachstreamer weltweit. Er streamt regelmäßig
auf Plattformen wie Twitch und YouTube, spielt vor allem schnelle Partien,
Blitz, Bullet, oft auch mit besonderen Bedingungen, wie mit einem Handicap oder blind,
ohne Sicht auf das Schachbrett. Zudem interagiert er intensiv mit seiner Community.
Gerade im Online-Schach spielt die Zeitkontrolle eine zentrale Rolle, nicht nur im klassischen Siel. Ob ultraschnelle Bulletpartien mit nur einer Minute pro Spieler oder ausdauernde Matches mit 90 Minuten Bedenkzeit. Ohne Schachuhr gäbe es kein
faires Spiel, keine gerechte Wertung und keinen Sieg durch Zeitüberschreitung.
Zeitüberschreitungen haben schon viele dramatische Momente im Schach hervorgebracht,
besonders im Blitzschach, wo jede Sekunde zählt. Für Magnus Carlsen, den vielfachen
Weltmeister im Blitz- und Schnellschach ist klar. Blitz ist ein anderes Spiel.
Man hat keine Zeit zum Nachdenken, gefragt sind, Intuition, Reaktionsschnelligkeit und
starke Nerven.
Für Garry Kasparov, eine der größten Schachlegenden, ist die Uhr der größte Feind des Strategen. Gerade in dem Moment, wenn der Kopf auf Hochtouren läuft und die Zeit unaufhaltsam verrinnt, spürt man die ganze Dramatik des Spiels. Ein klassischer Fall, wie die Uhr zum stärksten Gegner werden kann, selbst für die größten Spieler der Geschichte.
1966 in Santa Monica stand Bobby Fischer gegen Miguel Najdorf unter enormem Druck.
Die Stellung war bereits schwierig. Doch nun kam auch noch Zeitnot hinzu. Dann folgte der Fehler. Springer nach d6 - ein Zug, den Najdorf sofort ausnutzte. Wenige Züge später war die Partie vorbei. Wie Najdorf später kommentierte, war Fischer demoralisiert und übersah in der kritischen Stellung einen entscheidenden Zug.
Doch die Schachuhr ist nicht nur ein Zeitmesser, sondern auch ein unerbittlicher
Regelfaktor. Schauen wir uns dazu einige Turnieregeln an. Stellt euch vor,
die erste Runde eines Turniers beginnt, die Uhr startet und Weiß ist am Zug. Doch
sein Platz bleibt leer. Die Uhr läuft weiter, Sekunde für Sekunde.
Mit jeder verstrichenen Sekunde schwindet nicht nur seine Bedenkzeit, sondern auch die
Chance, überhaupt noch am Turnier teilzunehmen. Ist die Zeit abgelaufen,
zeigt die Uhr 0 an und die Partie ist verloren, ohne dass auch nur ein einziger Zug
gemacht wurde.
Manche Turniere gewähren eine sogenannte Wartezeit. Bei Mannschaftskämpfen etwa kann diese bis zu 60 Minuten betragen. Bei vielen offenen Turnieren oder Jugendturnieren liegt die Wartezeit oft bei 15 Minuten. Erscheint der Spieler innerhalb dieser Frist nicht am Brett, gilt die Partie als verloren. Die Wartezeit läuft dabei von der eigenen Bedenkzeit ab.
Gilt hingegen die Null-Toleranz -Regel, verliert ein Spieler automatisch, sobald er nicht pünktlich zum Rundenbeginn am Brett sitzt, selbst wenn er nur wenige Sekunden zu spät kommt. Seit 1883 steht sie neben dem Brett, die Schachuhr, Mal aus Holz, mal aus Plastik. Heute mit Blootooth.Sie zählt nicht nur Sekunden, sondern macht das Spiel erst zu dem, was es im Turnier ist: fair, fordernd und zeitlich begrenzt.
Man könnte sagen, die Uhr ist der 33. Stein auf dem Schachbrett. Nur, dass sie niemals gezogen sondern immer gedrückt wird.
Unsere Rubrik "Interessante Fakten über Schach":
Von der Messing-Doppeluhr aus dem 19. Jahrhundert bis hin zu den digitalen Wunderwerken von heute: Im Schachmuseum Ströbeck, in einem deutschen Dorf mit über 400-jähriger Schachtradition, bewahren diese Zeitzeugen die Geschichte des Schachs lebendig. Mal ticken sie noch. Mal stehen sie still, wie ein letzter Zug, der nie gemacht wurde.
Bis zum nächsten Mal,
eure Xenia Bayer